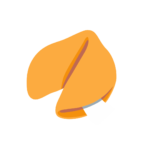Am 17. November findet die Aufführung von Michael Tippett’s Oratorium „A Child of Our Time“ statt, das die Geschichte der Reichskristallnacht thematisiert. Nicht wenige Sänger*innen haderten mit einer Teilnahme an dem aktuellen Stück: In der Rolle der Verfolger mit Überzeugung menschenverachtende Inhalte zu singen, das führte in uns zu heftigen Reaktionen der Ablehnung. Bei einem unserer Choristen kam auch die eigene Flüchtlingserfahrung hinzu. Wenngleich „A Child of Our Time“ sich nicht explizit mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt, so ergaben sich für ihn doch automatisch Assoziationen zu seinem eigenen Schicksal. Mit großer persönlicher Offenheit schildert er hier seine Erfahrung als Flüchtling und als Chorist.
Würdest du deine Flüchtlingsgeschichte kurz schildern?
Als ich 13 Jahre alt war, ist meine Mutter gemeinsam mit mir und meiner damals 5-jährigen Schwester am 2. Weihnachtsfeiertag morgens um 6 Uhr von Leipzig nach Westberlin geflüchtet. Ich wusste damals schon, dass dieses eine strafbare Handlung unter dem Begri “Republikflucht“ war; die mit mindestens fünf Jahren Zuchthaus geahndet wurde. Wir Kinder wären je nach Alter in ein Heim gesteckt oder zwangsadoptiert worden. Die Angst, die eine solche Flucht auslöst, kann ich kaum beschreiben. Zweimal ist meine Mutter mit mir geflohen. Das erste Mal als sogenannter „Binnenflüchtling“, diesen Begriff gab es aber zur damaligen Zeit noch nicht. Meine Mutter verließ mit mir als Säugling unseren Heimatort Leipzig im Februar 1944 wegen der Bombenangriffe der Alliierten und floh zu unserer Verwandtschaft ins Erzgebirge. Von dieser Flucht weiß ich heute nur aus Erzählungen meiner Mutter. Aus diesem Grund kann ich mir jedoch gut vorstellen, was heute Mütter aus Kriegsgebieten umtreibt, wenn sie die Flucht ergreifen, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten.
An einem Punkt warst du drauf und dran, deine Mitarbeit bei diesem Chorprojekt wegen deiner Flüchtlingserfahrung aufzugeben. Welche Erfahrung wurde wieder wachgerufen, war es ein bestimmtes Musikstück oder Szene, die dies tat?
Nach mehreren Proben, und als der Regisseur und die Dramaturgin hinzukamen, war mir klar: Hier kann ich nicht „mitspielen“. Es kamen längst abgelegte Erin- nerungen in mir hoch. Die starke, ja fast drastische Darstellung der Ablehnung der Flüchtlinge, die vom Regisseur gefordert wurde, hat mich fast zerrissen. Auf keinen Fall konnte ich das spielen. Alles, was ich am eigenen Leibe erfahren hatte, wiederholte sich plötzlich: Ich erinnerte mich an die Angst, die wir hatten, bevor wir Westberlin erreichten. Auch an die Angst später an unserem Zielort im Westen. Und an das Gefühl mit Ausnahme meiner Eltern im Übrigen von allem verlassen und getrennt zu sein, was mir mal lieb und wert war. Den Neuanfang mit all seinen Hindernissen und Beschwernissen vergisst man auch nach Jahren nicht.
Was hat dich schließlich bewogen, doch mitzusingen?
Trotz aller Problematik, die dieses Werk innehat, bin ich nach einem Gespräch mit unserem Chorleiter bereit, den musikalischen Teil des Oratoriums mitzusingen, werde mich aber an dem szenischen Teil nicht beteiligen. Ich sehe diesen Kompromiss nicht als besondere Großtat an, aber ich kann nicht anders.
Was hoffst du, kann das Stück beim Publikum bewirken?
Ich hoffe, dass das Publikum mindestens halb so betroffen ist wie ich. Ich hoffe ebenso, dass wir das Publikum zum Nachdenken anregen werden und der ein oder andere seine Einstellung zu Flucht und Vertreibung neu überdenkt. Wir haben durch die Menschen, die bei uns Zuflucht und Schutz gefunden haben, nichts verloren. Im Gegenteil, denn einige werden auf lange Sicht wieder in ihre Heimat zurückkehren und dort ein Gewinn sein und andere werden bleiben; was sich als Gewinn für unser Land erweist. Das ist mein Fazit, auch wenn es naiv klingt – ich glaube daran.